Anmerkungen
Wiesbaden
August/September 1942
Ein rauchender Polizeioffizier steht hinter dem Viehgatter an der Verladerampe. Verfolgte gehen den Bahnsteig entlang, unter ihnen der auffällig große Musiker Selmar Victor. Ein Helfer mit hochgekrempelten Ärmeln läuft in die entgegengesetzte Richtung, vermutlich um Gepäckstücke zu holen.
Anmerkungen
Personen
2
Schlagworte
6
Das Verfolgungsereignis
Deportation von Wiesbaden nach Theresienstadt am 1. September 1942
Am 1. September 1942 fand in Wiesbaden die dritte Großdeportation von als Jüdinnen und Juden verfolgten Personen statt. Auf Weisung der Gestapo Frankfurt wurden gezielt Menschen über 65 Jahre deportiert. Rund 350 Personen sollten sich am 29. August 1942 bis spätestens 13 Uhr in der von der Gestapo als Sammellager missbrauchten Synagoge in der Friedrichstraße einfinden. 40 Menschen begingen in der Woche nach der Ankündigung der Deportation Suizid. Im Sammellager mussten sich die Verfolgten ein 18 auf sieben Zentimeter großes Pappschild mit ihrem Namen und ihrer Kennnummer umhängen. Nach drei Tagen unter beengten Verhältnissen mussten die Menschen am 1. September 1942 um vier Uhr morgens zu Fuß zur Viehverladerampe des Wiesbadener Hauptbahnhofs laufen, die ursprünglich für den benachbarten Schlachthof angelegt worden war. Dort mussten sie einen Zug besteigen, der in Frankfurt am Main an den Deportationszug „Da 503“ nach Theresienstadt angeschlossen wurde. In Theresienstadt wurden 268 der 1.100 Deportierten bald nach ihrer Ankunft nach Treblinka weiterverschleppt.
Über die Bildserie
Wie viele Bilder von der Deportation aus Wiesbaden angefertigt wurden, ist unbekannt. Aktuell weiß die Forschung von 38 Fotos, die als Negative überliefert wurden. Diese sind allerdings derzeit nicht auffindbar. Sie zeigen zumeist ältere Personen, die im Hof der als Sammellager missbrauchten Synagoge in der Friedrichstraße 33 auf die „Registrierung“ warten, den überfüllten Gebetsraum und die Abfahrt der mehr als 350 Menschen von der zum Schlachthof gehörenden Viehverladerampe am Wiesbadener Hauptbahnhof. Die Bilder entstanden am 29. August und 1. September 1942, eventuell auch an den Tagen dazwischen. Neben den Deportierten sind zahlreiche namentlich bisher nicht identifizierte Tatbeteiligte sowie jüdische Hilfskräfte zu sehen, die die Menschen im Sammellager versorgten.
Fotograf:in
Unbekannt, Unbekannt
Wer die Wiesbadener Deportation fotografierte, ist nicht bekannt. Laut des Hessischen Hauptstaatsarchivs stammen die Bilder möglicherweise von Willi Rudolph. Der am 17. Januar 1898 geborene Wiesbadener war Fabrikangestellter und Hobbyfotograf, bevor er 1942 beim „Nassauer Volksblatt“ als Fotograf dienstverpflichtet wurde. Im Februar 1942 trat er der NSDAP bei und fotografierte in ihrem Auftrag bei mehreren Gelegenheiten. Im selben Jahr gründete er die später stadtweit bekannte Firma Foto Rudolph. Eine Beteiligung an der Deportation in jeglicher Form stritt er zu Lebzeiten ab. Sein Sohn Richard Rudolph gab nach Willi Rudolphs Tod an, die Bildserie im Bestand eines Polizeioffiziers gefunden zu haben, den dessen Witwe sie seinem Vater übergeben habe.
Überlieferung
Die Wiesbadener Deportationsserie wurde in den 1980er Jahren bekannt, als einige aus der Sammlung des Fotografen und Fotolaboranten Richard Rudolph stammende Bilder für eine Ausstellung im Rathaus genutzt wurden. Nach der Ausstellung gerieten über Richard Rudolphs Laden durch den Kauf durch Überlebende immer wieder Sets von Bildern in verschiedene Archive im Ausland, die sich allerdings in Anzahl und Auswahl der Motive unterschieden. 1998 wurde für die Konzeption eines mobilen Gedenkcontainers erstmals mit der vollständigen Serie gearbeitet. Seit 2011 liegt die gesamte Sammlung „Foto Rudolph“ im Hessischen Hauptstaatsarchiv. Die Negativfilme sind jedoch verschollen und eine vollständige Kollektion hochauflösender Digitalisate oder Abzüge existiert heute nicht mehr.
Signatur bei der besitzenden Entität:
3008/2 Nr. 16577
Bezeichnung des Bildes bei der besitzenden Entität:
Deportation von jüdischen Wiesbadenern an der Verladerampe des Schlachthofs, Bild 17
Danksagung
Ein herzlicher Dank geht an Kay Dreyfus, die die Fotos intensiv erforscht und maßgeblich zu unserem Verständnis der Wiesbadener Bildserie beigetragen hat. Daneben möchten wir uns bei Dr. Lukat aus dem Stadtarchiv Wiesbaden und Dr. Lehnhardt aus dem Hessischen Hauptstaatsarchiv für die hilfreichen Dokumente und Informationen bedanken.
Text und Recherche: Lisa Paduch.
Kooperationsverbund #LastSeen. Bilder der NS-Deportationen Dr. Alina Bothe Projektleiterin
c/o Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg
Freie Universität Berlin
Habelschwerdter Allee 34A
14195 Berlin
lastseen@zedat.fu-berlin.de
Ein Kooperationsprojekt von
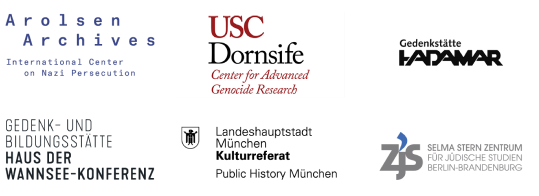
Gefördert durch

Datenschutz | Impressum