Anmerkungen
Liebenau
02.10.1940
Hinter einem roten Bus der Reichspost überprüft Personal der Anstalt Liebenau die Identität von mehreren Patienten, während T4-Personal ihnen den Unterarm bestempelt. Der rote Reichspostbus, in dem die Männer in die Tötungsanstalt Grafeneck deportiert wurden, ist noch leer.
Anmerkungen
Personen
3
Schlagworte
2
Das Verfolgungsereignis
Deportation von Liebenau nach Grafeneck am 02.10.1940
Aus der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Liebenau (heute Stiftung Liebenau) und dem dazugehörigen Gertrudisheim Rosenharz wurden zwischen Juli 1940 und April 1941 über 500 Menschen zur Ermordung im Rahmen der NS-„Euthanasie“ verschleppt. Am 2. Oktober 1940 fand die letzte große „Verlegung“ aus Liebenau statt. Die Betroffenen wurden an jenem Mittwochmorgen von Personal der Tötungsanstalt Grafeneck vor dem Eingang des St. Josef Hauses abgeholt. Von den 100 Liebenauer Patient:innen, die auf der Transportliste des Innenministeriums geführt waren, gelang es Anstaltsleiter Josef Wilhelm mit dem Anstaltsarzt und einer Schwester noch 25 Menschen zurückzustellen. Die Übrigen brachte das Liebenauer Pflegepersonal aus ihren Wohnhäusern zu den drei ehemaligen Postbussen. Vor dem Einstieg wurde ihre Identität geprüft und sie erhielten einen Stempel auf den Unterarm. Die 75 Menschen wurden nach Grafeneck deportiert, 74 von ihnen wurden dort mit Kohlenmonoxid-Gas ermordet. Eine Person, die an Parkinson erkrankte Maria Spiess, wurde aus heute unbekannten Gründen zurückgestellt und in die staatliche Anstalt Zwiefalten gebracht, wo sie 1941 starb.
Über die Bildserie
Auf einem glasgerahmten Farbdia hat Pfarrer Alois Dangelmaier die Deportation von 75 Bewohner:innen der Heil- und Pflegeanstalt Liebenau am 2. Oktober 1940 festgehalten. Heute liegen im Archiv der Stiftung Liebenau zwar zahlreiche Versionen des Dias, doch das Original ist verloren gegangen oder als solches nicht mehr zu erkennen. Der Originalrahmen wies die Beschriftung „1.3.5.6 Euthanasie-Transport Liebenau 1940, aufgn. von Pfr. Alois Dangelmaier, Dr. med G. Ritter, Schw. M. Fausta“, wobei letztere Namen sich auf abgebildete Personen beziehen. Dangelmaier fotografierte aus dem Fenster des damaligen Josefhauses, seine Position ist daher gegenüber dem Geschehen leicht erhöht. Im Schatten am linken Bildrand deutet sich der Fensterrahmen an. Zu sehen ist sowohl Personal der Stiftung Liebenau als auch der Tötungsanstalt Grafeneck bei der Registrierung der zu deportierenden Patient:innen vor einem Bus der Reichspost.
Fotograf:in
Alois Dangelmaier, Pfarrer
Alois Dangelmaier wurde am 25. März 1889 in Stuttgart geboren. 1913 wurde er zum katholischen Priester geweiht. Er war während seiner Berufstätigkeit Stadtpfarrer in Oeffingen, Metzingen und Mühlheim sowie Vikar in Ravensburg-Liebfrauen. Dangelmaiers Freundschaft mit dem 1933 abgesetzten Württembergischen Staatspräsidenten ermöglichte ihm wahrscheinlich seine Aufenthalte in der Anstalt Liebenau während der Kriegsjahre. Während dieser Urlaube war er dort als Seelsorger für die Patient:innen und Beichtpriester für die Ordensschwestern tätig. Das Predigtbuch der Anstalt belegt auch einen Aufenthalt im Oktober 1940, während dessen er das Deportationsbild aufnahm. Dangelmaier starb 1968 in Ravensburg, wo er sich zur Ruhe gesetzt hatte.
Überlieferung
Ende der 1950er Jahre übergab der Fotograf Pfarrer Alois Dangelmaier dem damaligen leitenden Arzt der Heil- und Pflegeanstalt Liebenau, Dr. Bernhard Ehrmann, ein Päckchen mit 31 Diapositiven. Sie zeigten Bilder von Dangelmaiers Aufenthalten in der Anstalt in den Jahren 1940 bis 1942. Bis zum 100-jährigen Jubiläum der Stiftung Liebenau im Jahr 1970 behielt dieser die Bilder für sich. Seit der Veröffentlichung durch Ehrmann 1970 spielt das Deportationsfoto eine zentrale Rolle im Gedenken an die „Euthanasie“-Morde in der Stiftung Liebenau und bundesweit. Heute sind Dangelmaiers Bilder in den Beständen der Stiftung Liebenau verteilt und nicht mehr identifizierbar.
Signatur bei der besitzenden Entität:
Ohne Signatur
Bezeichnung des Bildes bei der besitzenden Entität:
Stiftung Liebenau Busbild
Danksagung
Wir danken Susanne Droste-Gräff von der Stiftung Liebenau für die engagierte Unterstützung, sowie Kathrin Bauer von der Gedenkstätte Grafeneck für ihr Expertinnenwissen.
Text und Recherche: Lisa Paduch.
Kooperationsverbund #LastSeen. Bilder der NS-Deportationen Dr. Alina Bothe Projektleiterin
c/o Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg
Freie Universität Berlin
Habelschwerdter Allee 34A
14195 Berlin
lastseen@zedat.fu-berlin.de
Ein Kooperationsprojekt von
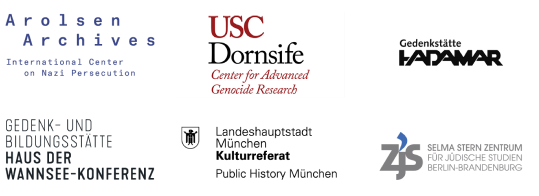
Gefördert durch

Datenschutz | Impressum