Anmerkungen
Kulmbach
23.04.1942
Das Ehepaar Flörsheim am Vorabend der Deportation.
Anmerkungen
Personen
2
Schlagworte
2
Das Verfolgungsereignis
Deportation von Kulmbach nach Krasnystaw
Am Morgen des 24. April mussten die sieben noch in Kulmbach wohnenden Jüdinnen:Juden aus ihren Wohnungen zum Güterbahnhof gehen. Wer sie bewachte, ist unklar. Am Bahnhof erhielten sie vor-nummerierte „Anhängezettel“ und bestiegen einen Zug nach Bamberg, der in weitem Bogen über Kronach, Coburg und Lichtenfels noch weitere Deportationsopfer aufnahm.
In Bamberg wurden insgesamt 103 Jüdinnen:Juden im überfüllten Gemeindezentrum „Weiße Taube“ untergebracht. Am nächsten Morgen wurden die Menschen von der Gestapo zum Bahnhof getrieben. Dort mussten sie den Sonderzug DA 49 besteigen, der über Saalfeld, Kalisz, Radom und Lublin nach Krasnystaw fuhr.
Von dort aus sind die fränkischen Jüdinnen:Juden im Juli 1942 nach Belzec gebracht und dort ermordet worden.
Keiner der 955 Deportierten überlebte.
Über die Bildserie
Ein Mann und eine Frau stehen in einem einfach eingerichteten Raum und schauen in die Kamera. Der Mann neigt seinen Kopf nach rechts und blickt direkt in die Kamera. Er trägt ein kragenloses Hemd, ein Jackett, an dem eine Uhrenkette – und ein gelber Stern – schimmern. Seine rechte Hand – mit Ehering am Ringfinger – ruht auf einem feldmarschmäßig gepackten Rucksack, der auf einem Stuhl steht. Sorgfältig eingeschlagen ein Kopfkissen, eine eingerollte Decke, ein Kochtopf und-genagelte Stiefel. Die Frau im dunklen Kleid – möglicherweise auch mit Schürze – trägt eine Handtasche und Ohrringe. Sie lächelt.
Angesichts des gelben Sterns und des typischen “Marschgepäcks” ist mit großer Sicherheit anzunehmen, dass es sich um ein jüdisches Ehepaar handelte, dass kurz darauf deportiert wurde.
Fotograf:in
Unbekannt,
Das Foto wurde ganz offensichtlich mit Zustimmung, möglicherweise sogar im Auftrag der Abgebildeten gemacht.
Da das Bild entwickelt und überliefert ist, ist davon auszugehen, dass es sich um jemanden handelte, der nicht deportiert wurde. Wahrscheinlich handelte es sich um eine*n nicht-jüdische*n Nachbar*in, der/die den Flöhrsheims trotz jahrelanger Diskriminierung noch verbunden war und das Risiko auf sich nahm, sie vor der Deportation zu besuchen.
Da Jüdinnen:Juden der Besitz einer Kamera im November 1941 verboten worden war, hatte der/die Unbekannte wahrscheinlich eine Kamera mitgebracht.
Überlieferung
Das Einzelbild gelangte auf unbekannten Wegen in das Archiv der Gedenkstätte Yad Vashem. Nicht unwahrscheinlich, dass eins der überlebenden Kinder von Selma und Gustav Flörsheim das Foto dort abgab. Allen drei Kindern Vera, Käthe Flörsheim (geb. 1914); Ilse Flörsheim (geb. 1915) und Herbert Flörsheim (geb. 1920) war die Flucht gelungen. Wie sie aber an das Foto gekommen sein könnten, ist unbekannt.
Möglich ist auch, dass das Foto dem ehemaligen Synagogenschreiber, der 1953 kurz nach Kulmbach zurückkehrte, übergeben wurde. Hierfür spricht, dass das Foto in einem Gedenkblatt für die Gemeinde Kulmbach abgebildet wurde, das von der Gedenkstätte Yad Vashem herausgegeben wurde.
Signatur bei der besitzenden Entität:
103F08/FLO47
Bezeichnung des Bildes bei der besitzenden Entität:
Kulmbach/Kronbach
Danksagung
Der Eintrag beruht auf jahrelangen Recherchen des Historikers Wolfgang Schobert, Kulmbach.
Text und Recherche: Christoph Kreutzmüller.
Kooperationsverbund #LastSeen. Bilder der NS-Deportationen Dr. Alina Bothe Projektleiterin
c/o Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg
Freie Universität Berlin
Habelschwerdter Allee 34A
14195 Berlin
lastseen@zedat.fu-berlin.de
Ein Kooperationsprojekt von
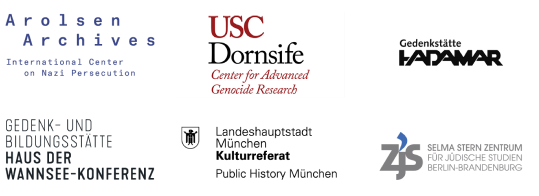
Gefördert durch

Datenschutz | Impressum